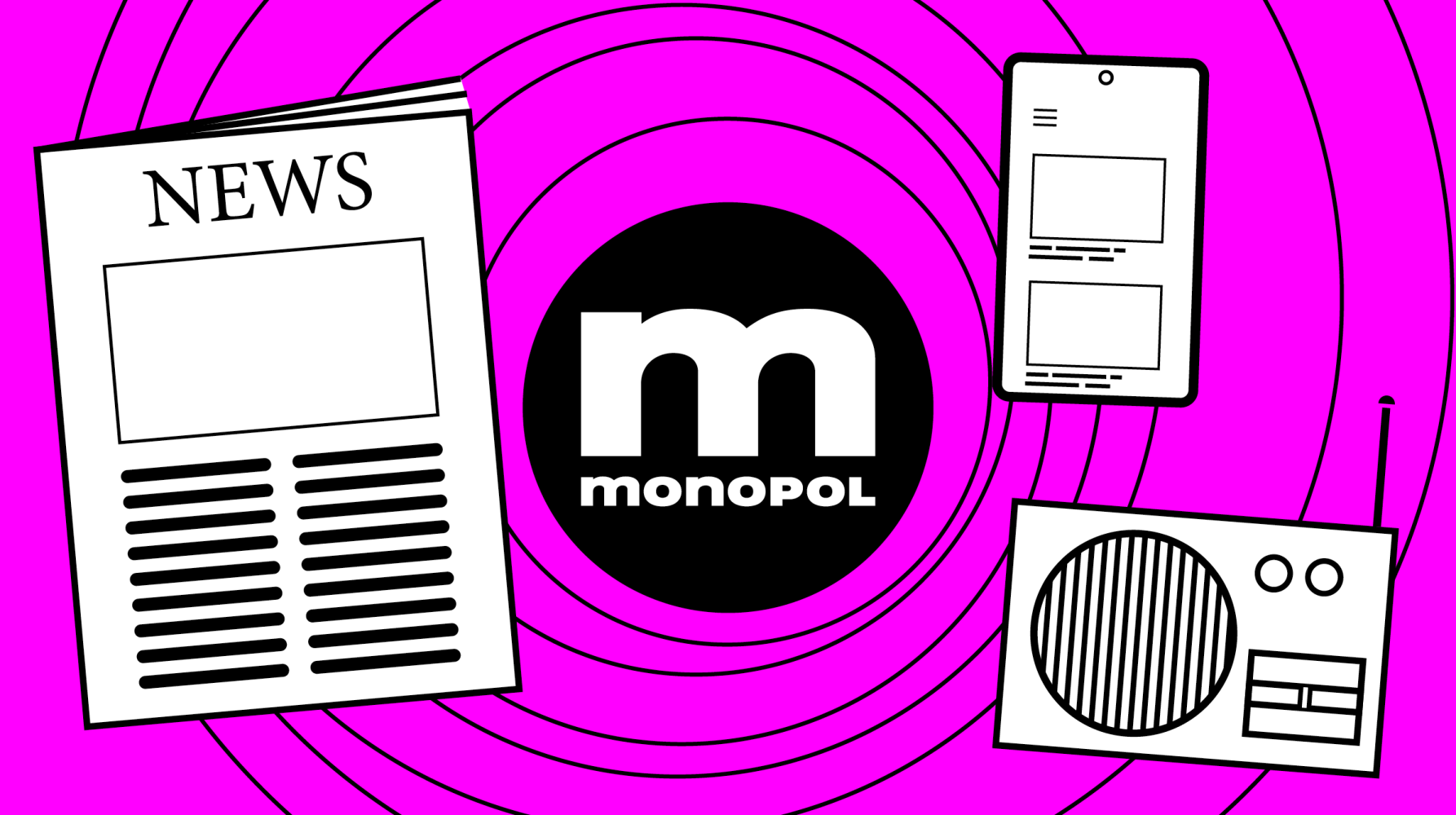Kulturpolitik
In einem scharf formulierten FAZ"-Kommentar bezeichnet Simon Strauß das Kulturkapitel des neuen Koalitionsvertrags als "beschämend" und symptomatisch für den Bedeutungsverlust von Kultur in Deutschland. Statt die Rolle einer Kulturnation zu stärken, werde das Land nur noch als "Kulturstaat" bezeichnet – eine weichgespülte Formel, die laut Strauß den Stellenwert von Kunst und Kultur im politischen Denken entlarve. Die Passage zur Kultur falle im Vergleich zu anderen Themen auffällig kurz und substanzarm aus "Die nicht einmal sechs Seiten bieten eine fade Lektüre – vom Bestseller so weit entfernt wie der raketenbegeisterte Markus Söder vom Mars. Es geht um Förderpolitik und gesetzliche Rahmenbedingungen, Erinnerungskultur und Gedenkstättenpolitik." Strauß fehlen konkrete Visionen und eine erkennbare Handschrift des mutmaßlich neuen Kulturstaatsministers Joe Chialo. Stattdessen würden vor allem organisatorische und fördertechnische Maßnahmen umrissen – etwa die Anerkennung von Clubs als Kulturorte, das mögliche Aus für Projekte wie den Kulturpass und eine stärkere Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. "Die Abkehr vom Kolonialismus-Schwerpunkt und seine Ersetzung durch eine gestärkte SED-Aufarbeitung" sei "einer der wenigen inhaltlichen Signifikanten des Kulturkapitels. Dem Vernehmen nach wurde er vor allem von ostdeutschen Stimmen in der Arbeitsgruppe beworben." Die Formulierungen zur Rolle von KI in der Kultur findet Strauß "beschämend arglos", sie wirkten in ihrer technokratischen Beliebigkeit geradezu dystopisch. Dass Kultur im Koalitionsvertrag nur so wenige Seiten einnimmt, wertet Rüdiger Schaper im "Tagesspiegel" hingegen positiv: "Die Formulierungen im Ampel-Vertrag zur Kultur klangen übergriffiger."
Restitution
Tobias Timm beleuchtet in der "Zeit" den Umgang des Freistaats Bayern mit NS-Raubkunst am Beispiel von Max Beckmanns Gemälde "Tanz in Baden-Baden", das sich derzeit im Depot der Münchner Pinakothek der Moderne befindet. Trotz eindeutiger Hinweise, dass das Werk ursprünglich dem jüdischen Sammler Heinrich Fromm gehörte und ihm im Zuge der NS-Verfolgung entzogen wurde, verweigern die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen eine klare Restitutionsprüfung. Fromm wurde 1938 ins KZ Dachau deportiert, konnte später nach London fliehen. "Der Tanz in Baden-Baden ist ein neues, skandalöses Beispiel dafür, wie eine Aufarbeitung von NS-Verbrechen noch heute, achtzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, von manchen Stellen verschleppt wird." Statt Transparenz herrsche Verschleppung: Das Gemälde wurde bislang nicht in die Lost-Art-Datenbank aufgenommen, und die Museumskategorie "gelb" verharmlost mögliche NS-Enteignungen. Recherchen belegen jedoch eine Urkunde, die Fromms Eigentum stützt. Auch der Skandal um den Umgang mit weiteren Werken – fast 200 davon intern als "rot" (höchste Verdachtsstufe) gelistet – rückt Bayern erneut in ein schlechtes Licht.
Marcus Woeller beschreibt in der "Welt", wie Künstliche Intelligenz zunehmend in der Provenienzforschung eingesetzt wird, um Raubkunst aus der NS-Zeit aufzuspüren. Im Fokus steht die neue digitale Plattform der Jewish Digital Cultural Recovery Project Foundation, die diese Woche vorgestellt wurde: "Die Datenbank verwendet dafür eine generative KI-Software, um die Suche, die Verknüpfung und den Abgleich von Dokumenten zu erleichtern. Angefangen mit dem Museumsarchiv Jeu de Paume in Paris greift es dafür auf verschiedene Archive in Europa zurück, weitere sollen folgen. Die Nutzer sollen mit der Datenbank ein Handwerkszeug bekommen, um Erkenntnisse über die Herkunft, die erzwungene Veräußerung oder den Diebstahl sowie die mögliche Wiederbeschaffung fraglicher Objekte zu gewinnen."
Kunstmarkt
Die Berliner Galerie Peres Projects wurde letzte Woche von einem deutschen Gericht für insolvent erklärt. Der Berliner Anwalt Christian Otto bestätigte gegenüber "Artnet News", dass er zum Insolvenzverwalter der Galerie ernannt wurde. Die Berliner Niederlassung der Galerie habe zuletzt im Februar eine Ausstellung gezeigt, berichtet Eileen Kinsella, während der Standort in Mailand seit Dezember seinen Betrieb eingestellt habe. Die Dependance in Seoul präsentiert derzeit eine Ausstellung von Hermann Nitsch, die bis Mai läuft. Ein Mitarbeiter der Galerie teilte mit, dass Peres in Elternzeit mit seinem neugeborenen Sohn sei und voraussichtlich im Mai weitere Informationen bereitstellen werde. Peres Projects wurde 2003 von Javier Peres gegründet und hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Karrieren zahlreicher aufstrebender Künstler gefördert, darunter Terence Koh und Dan Colen.
KI
Der Maler David Salle reflektiert in einem "ArtReview"-Essay über die Möglichkeit, Künstliche Intelligenz als kreatives Werkzeug in der Kunst zu nutzen. Dabei vergleicht er die Einführung von KI in den künstlerischen Prozess mit früheren technologischen Innovationen wie Ölmalerei oder Fotografie. Für ihn ist KI kein eigenständiger "Künstler", sondern ein Werkzeug, das Bildkomponenten neu kombinieren kann, ohne jedoch echte künstlerische Intention zu entwickeln. "Sie ist im Wesentlichen ein Amalgamierer. Der 'denkende' Teil der Maschine, der Algorithmus, scheint eine Art Trieb zu haben, Bilder zu zerlegen und ihre Bestandteile neu zu kombinieren, irgendwie ihre ursprüngliche räumliche Orientierung zu verwirren, aber ihren emotionalen Subtext zu erhalten und sogar zu verstärken." Der Hauptunterschied zwischen Malerei und digitalen Bildern liegt für Salle im "Rand", der in der Malerei eine bedeutungsvolle, gestische Handlung darstellt, während digitale Bilder oft flach und unpersönlich wirkten. Um KI künstlerisch zu nutzen, entwickelte Salle ein "Curriculum", um der Maschine grundlegende künstlerische Prinzipien beizubringen – wie den Umgang mit Pinselstrichen, Kontrasten und Kompositionen. Er fütterte sie mit Werken von Künstlern wie Hopper und de Chirico sowie eigenen, formal reduzierten Bildern. Auf dieser Grundlage sollte die KI neue, dynamische Bildräume schaffen, die die plastische, imaginative Kraft menschlicher Kunst idealerweise mit den Möglichkeiten der Technologie verbinden.