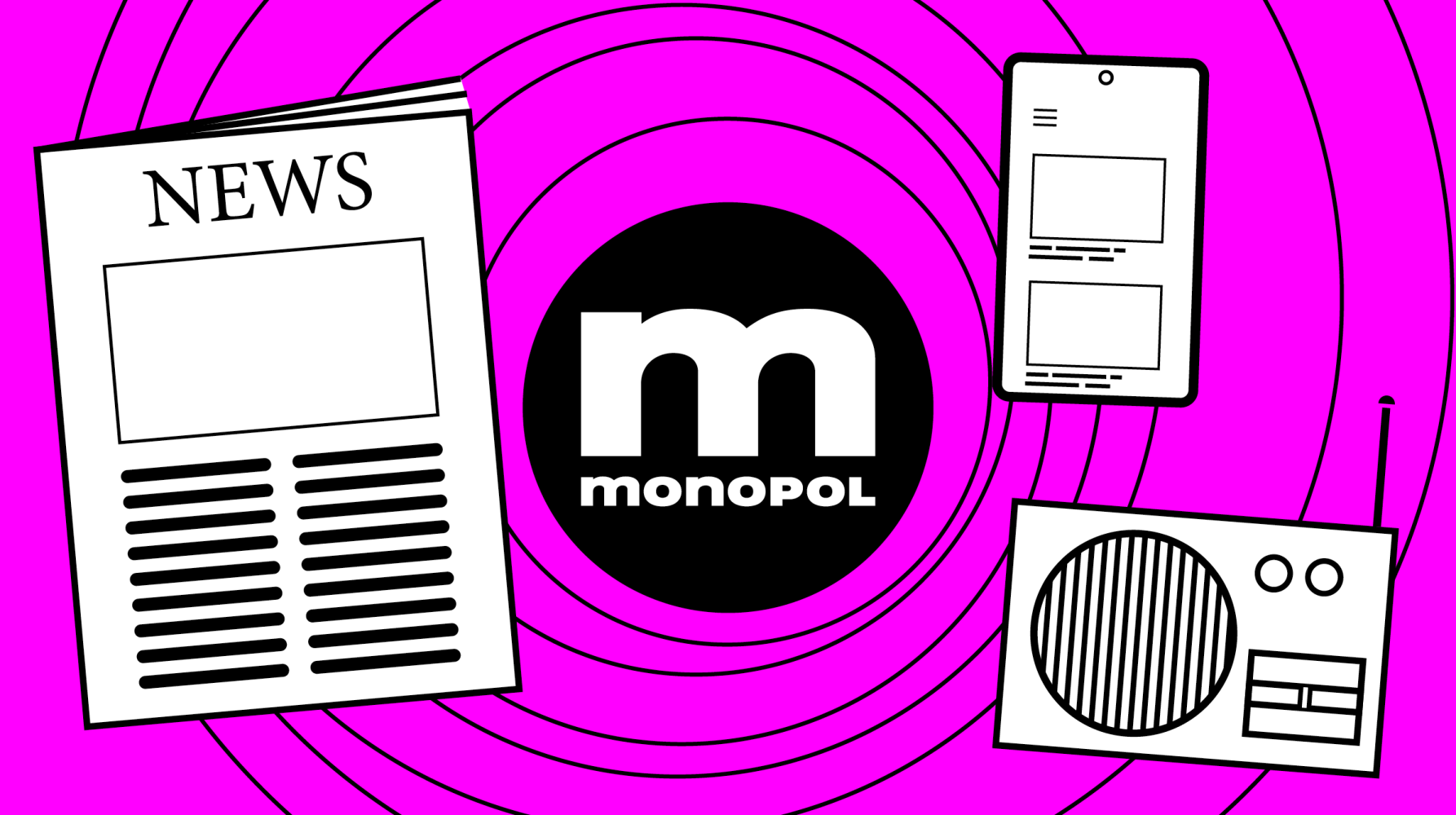Kunst im öffentlichen Raum
Statuen und andere Kunstwerke im Freien sind oft Ziel von Diebstahl und Vandalismus. So wurde etwa in Magdeburg gerade einer Bronzefigur der Arm abgerissen, in Leuna verschwanden gleich drei Skulpturen. Die Polizei vermutet oft Metalldiebstahl als Motiv, Kunstraub im engeren Sinne liegt selten vor. Die Direktorin des Kunstmuseums Magdeburg, Annegret Laabs, sieht in einen Beitrag von MDR Kultur die Ursache auch im schwindenden öffentlichen Bewusstsein für Kunst im Alltag: "Das Bewusstsein dafür, dass es überhaupt Kunst im öffentlichen Raum gibt, dass sie wertvoll ist, [...] verschwindet immer mehr." Die Bevölkerung nehme kaum noch Anteil – auch weil es weniger neue Kunst im öffentlichen Raum gebe. Dadurch erscheine vorhandene Kunst als "irgendwas von vorgestern, was ich dann auch nicht so schätze". Ein Gegenbeispiel ist das Kunstprojekt Purple Path der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Dort verbinden monumentale Skulpturen verschiedene Gemeinden, bislang ohne Zwischenfälle. Kurator Alexander Ochs betont: "Alle Arbeiten sind versichert. [...] Wir haben ja schon sehr viel draußen seit vielen Jahren und es ist nichts beschädigt worden." Die Werke seien massiv befestigt und öffentlich gut einsehbar. Annegret Laabs mahnt, dass es auch strukturelle Veränderungen brauche. "Öffentliche Räume werden immer häufiger privatisiert", und ohne gezielte Förderung könnten Kommunen keine nachhaltige Kunstprojekte stemmen. Außerdem sei heutige Kunst oft komplexer: "Die Kunst heute ist nicht mehr so einfach [...], sie braucht mehr Einfühlungsvermögen."
Kunstmarkt
Im Jahr 2024 sind die weltweiten Auktionserlöse zeitgenössischer Kunst um 27 Prozent auf 698 Millionen US-Dollar gefallen – ein deutlicher Rückgang gegenüber 956 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Das geht aus dem aktuellen Hiscox Artists Top 100 Report hervor, den sich Karen K. Ho für "ARTnews" vorgenommen hat. Besonders stark betroffen war der Markt für junge Kunst: Verkäufe von Werken unter 45-jähriger Künstlerinnen und Künstlern, die innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Entstehung versteigert wurden, brachen um 64 Prozent ein. Fast ein Fünftel dieser Werke blieb unverkauft – der höchste Anteil seit sieben Jahren. Trotz dieser Rückgänge gab es auch positive Entwicklungen: Die Zahl der bei den großen Auktionshäusern angebotenen Künstlerinnen und Künstler stieg auf 2602, darunter deutlich mehr Frauen. Yayoi Kusama war erneut die umsatzstärkste Künstlerin mit 58,8 Millionen US-Dollar, gefolgt von François-Xavier Lalanne. Während New York Marktanteile gewann, verlor Hongkong massiv. "Das spekulative Fieber ist vorbei – jetzt ist der Markt deutlich abgekühlt", so Robert Reed von Hiscox. Käufer würden nun Zeit haben, Entscheidungen zu treffen.
Ausstellung
Peter Richter zeigt in einem "SZ"-Artikel, wie die deutsche Lebensreformbewegung des frühen 20. Jahrhunderts über Kalifornien bis ins moderne Silicon Valley wirkte, mit überraschenden kulturellen wie politischen Nachwirkungen, die "die Welt heute noch in Atem" hielten. Ausgangspunkt war unter anderem der Künstler Hugo Höppener alias Fidus, dessen Bild "Lichtgebet" vom Postkartenmotiv des Kaiserreichs zum Symbol der Hippie-Bewegung in San Francisco wurde. "Was die freundlichen Hippies von San Francisco in seinem sonnenanbetenden Knaben sahen? Wahrscheinlich eher einen der Ihren", schreibt Richter. Dabei war die Körperhaltung der Figur eine nachgestellte germanische Lebensrune – für völkische Esoteriker einst Ausdruck "deutschtümelnden Yogas". Auch Fidus selbst erscheint bei Richter als zwiespältige Figur: ein "sektenführerhaft säuselnder" Prophet mit "härenem Kittel, Mähne und Vollbart", dessen Nähegesuch zu den Nazis letztlich erfolglos blieb. Mit der "Para-Moderne"-Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle rückt diese ambivalente Bewegung nun wieder ins öffentliche Bewusstsein. Besonders spannend ist die Geschichte der von Janos Frecot aufgebauten größten Sammlung zur Lebensreform. Keine deutsche Bibliothek wollte sie übernehmen – aus Angst vor politischer Vereinnahmung: "Die Angst vor den politischen Kontaminationen des Materials ist spektakulär." Stattdessen wanderte sie an die Stanford University, wo sie heute als "historische Quellensammlung zu den Urgründen der kalifornischen Gegenkultur" gilt, so Richter. Alexander Menden bespricht die Ausstellung, ebenfalls in der "SZ".
Restitution
In der "Zeit" spricht Carolin Würfel mit Lynn Rother, die zu den weltweit gefragtesten Provenienzforscherinnen zählt – "eine sehr berührende Arbeit, die ich am MoMA und im Rahmen meiner Professur an der Leuphana Universität in Lüneburg mache. Warum landete ein Kunstwerk an einem bestimmten Ort? Welche Zwänge und Entscheidungen führten dazu? Provenienzforschung beleuchtet die dunklen Seiten der Geschichte – Raub, Erpressung und die Grauzonen einer Gesellschaft", sagt Rother, die in der DDR geboren wurde. Die Frage nach der Ost- oder West-Herkunft sei vor zehn, 20 Jahren noch "sehr aufgeladen" gewesen, erklärt sie: "Direktoren aus dem Westen hatten die Spitzenpositionen erhalten, während Ost-Direktoren höchstens Stellvertreter wurden. Diese Hierarchisierung setzte sich auch in der Kunst fort, Gemälde aus dem Osten wurden häufig abgewertet". Den Begriff "DDR-Kunst" hält Rother für "pauschal und ignorant. Künstlerinnen wie Gabriele Stötzer oder Cornelia Schleime, die subversive und kritische Werke schufen, sollten nicht unter einem Begriff subsumiert werden, der sie mit der staatlich hofierten Kunst gleichsetzt. Und selbst innerhalb der vom Staat geförderten Kunst gab es ein breites Spektrum". In New York, wo sie inzwischen zum senior staff am MoMA gehört, frage niemand nach ihrer Herkunft. Es wurde "eine ganz neue Position für mich geschaffen – ich bin jetzt die erste Kuratorin für Provenienz am Museum of Modern Art und arbeite eher strategisch. Als Kind in der DDR hätte ich mir das nie vorstellen können", sagt Lynn Rother.
Atelierbesuch
Georg Imdahl schwärmt in der "FAZ" für Santiago Sierra, dessen hochumstrittene Kunstaktion in der Synagoge Stommeln bei Köln dem Autor eine unvergessliche Erfahrung bescherte. "Nie zuvor und nie danach" habe Imdahl "eine ähnlich radikale, herausfordernde Intervention erlebt". Für die Arbeit "245 Kubikmeter" hatte Sierra die seit Jahrzehnten nicht mehr als Bethaus genutzte Synagoge mit Abgasen aus laufenden Automotoren in den Straßen der kleinen Gemeinde gefüllt – das Publikum konnte sie nur mit Atemschutzmaske und in Begleitung eines Feuerwehrmanns betreten. Am Tag nach der Eröffnung im März 2006 wurde die Ausstellung unter massiven Protesten abgebrochen. Sierras Tenor lasse sich als "konfliktuelle Kunst" auf eine Formel bringen, so Imdahl. "All die Tattoo-Linien, die er Bedürftigen gegen kleines Geld auf den Rücken zeichnen ließ, die obskuren Haarschnitte und Haarfärbungen, die schwere, niedrig bezahlte Arbeit, für die er Tagelöhner in seinen Ausstellungen schuften ließ – Sierra hat sich wieder und wieder selbst als Ausbeuter inszeniert, um zu demonstrieren, dass auch die hehre Kunstwelt, der Markt auf Doppelmoral beruhen." Als Künstler mit Biss erweist sich Santiago Sierra auch dieser Tage – Imdahl berichtet von einer Fotoaktion, die auf Aufnahmen der Gebisse von Sinti und Roma in Neapel beruht. Die Bilder sind zurzeit auf die Außenfenster des Neuen Berliner Kunstvereins appliziert. Außerdem erwähnt der "FAZ"-Redakteur eine Soloschau in Sierras Geburtsstadt Madrid, "zudem wartet eine gerade abgedrehte, rund hundertminütige Dokumentation von Enrique Palacio über ihn auf ihre Premiere: 'Der Finger in der Wunde'". Ein Titel, der Sierras schmerzhafte Praxis eigentlich ganz gut beschreibt.