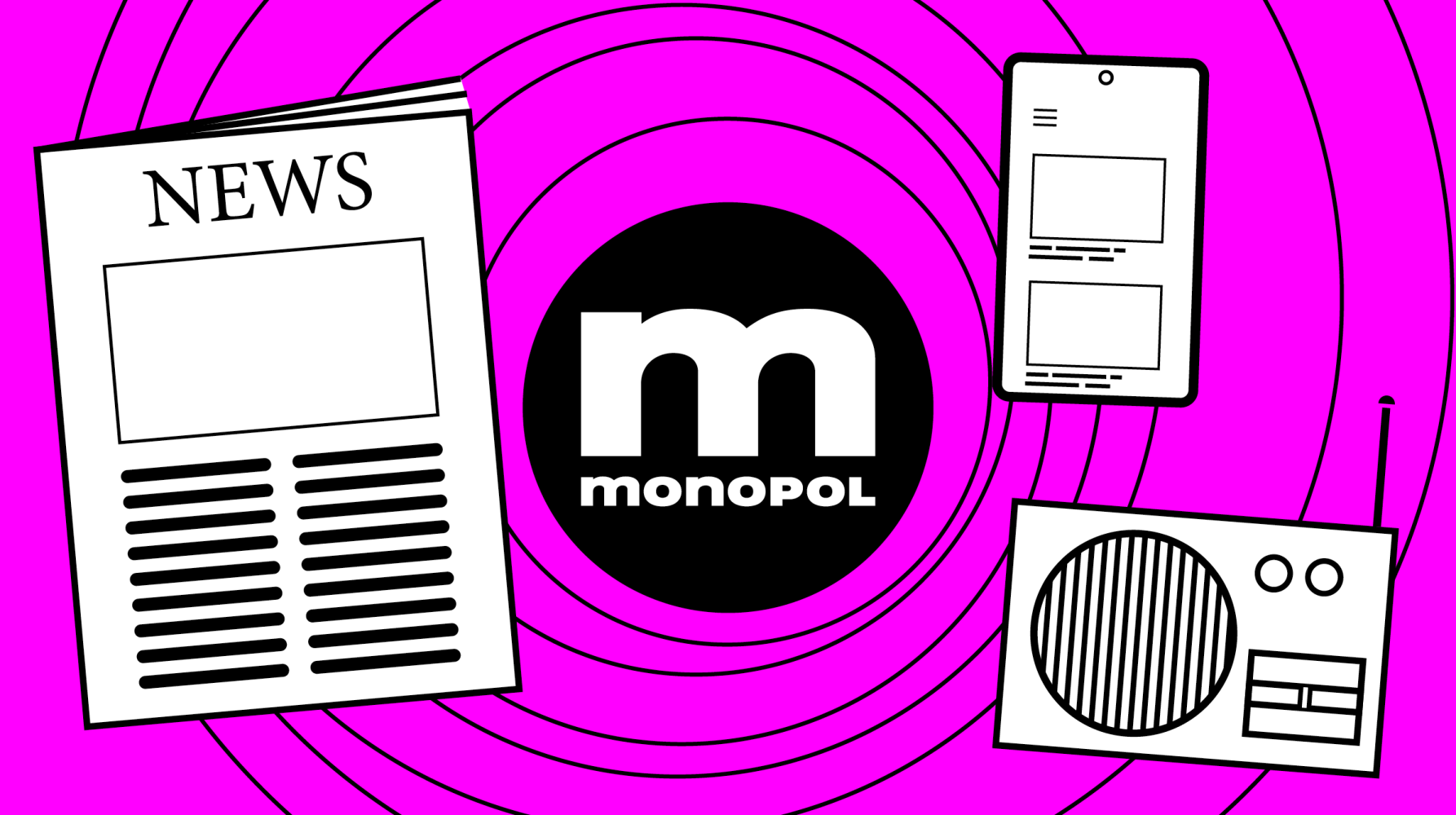Der Publizist und Verleger Wolfram Weimer wird Kulturstaatsminister – eine Entscheidung, die Jürgen Kaube in der "FAZ" irritiert. Weimers bisheriges Wirken habe doch kaum echtes Interesse an Kunst oder Kultur gezeigt, seine Äußerungen wirkten oft unverständlich und ideologisch verquer. "Weimer ein Interesse an irgendeiner Kunst oder Geist zu unterstellen, wäre spekulativ." In seinem "Manifest des Konservatismus" (2018) beklage er etwa eine "amoralische Renaissance" großer Künstler, trauere der Kolonialzeit nach und vermittele ein widersprüchliches und oberflächliches Geschichts- und Kulturverständnis. Kaube schreibt, Weimer sei "der falsche Mann am falschen Platz". Gerrit Bartels kommentiert im "Tagesspiegel": "Weimer hat sich bislang nicht gerade als jemand hervorgetan, der besonders kulturpolitisch engagiert ist." Während frühere Amtsinhaber wie Claudia Roth oder Monika Grütters ein klares kulturelles Interesse mitgebracht hätten, scheine bei Weimer eher Medien- und Wirtschaftsmanagement im Vordergrund zu stehen. Seine Berufung könnte "der Tatsache geschuldet sein, dass der kommenden Bundesregierung unter Friedrich Merz die Medienpolitik mehr am Herzen liegt als die Kulturpolitik." Man könne sie als weiteres Indiz dafür ansehen, dass die kommende Koalition der Kultur etwas ratlos gegenübersteht, meint Jörg Häntzschel in der "SZ". Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner kritisierte auf der Plattform X mit Blick auf Weimers publizistische Tätigkeit, der designierte Staatsminister habe "keine Erfahrung mit Theater oder Museen, Geschichte und Fakten werden verdreht oder sind nicht bekannt, Kolonialnostalgie inklusive. Das riecht nach Kulturpolitik aus der Schreibmaschine." Politische Erfahrung bringe er nicht mit, dafür ein weitreichendes konservatives Netzwerk, berichtet Ulrike Knöfel im "Spiegel". In Talkshows trete Weimer als wortgewandter Welterklärer auf, Kulturthemen spielten dabei bislang kaum eine Rolle. Weimers Kulturverständnis sei traditionell geprägt: In seinem "konservativen Manifest" beschreibe er Heimat im Sinne Heideggers als "das Boden-Ständige, ein Boden, der ständig da ist". Kritische Perspektiven wie postkoloniale Debatten seien ihm fremd. Für Monopol kommentiert Tobi Müller die Personalie.
Kunstmarkt
Im "Frieze"-Interview erläutert Laura Attanasio, Leiterin des neuen Berliner Standorts der Pace Gallery, die Pläne für die Dependance der US-Galerie, die in dieser Woche während des Gallery Weekend eröffnet. Trotz der aktuellen Kulturkürzungen wolle Pace die lokale Szene stärken: "Wir sollten nicht aufgeben. Wir müssen zusammenarbeiten – Galerien, Institutionen und Museen." Neben internationalen Künstlern sollen gezielt lokale Positionen eingebunden werden. Die Kooperation mit der Galerie Judin, mit der sich Pace eine frühere Tankstelle als Ausstellungsraum teilt, versteht sie als Modell der Zukunft. Auch Lesungen und Events, etwa mit "Die Zeit", seien geplant: "Wir wollen den Sommer in Berlin voll ausnutzen!"
Auf "Artnet News" schildert Margaret Carrigan, wie neue US-Zölle den internationalen Kunstversand erschweren. Zwar schütze der International Emergency Economic Powers Act ausdrücklich kulturelle Güter vor Handelsbeschränkungen, doch Antiquitäten und Designobjekte unterlägen der neuen allgemeinen Zehn-Prozent-Importabgabe. Dabei komme es häufig zu Missverständnissen bei der Zollabfertigung, etwa wenn Kunst und Möbelstücke – wie bei Werken von François-Xavier Lalanne – schwer zu unterscheiden seien. Logistische Probleme verschärfen die Lage: Eine DHL-Sprecherin berichtet von "mehrtägigen Verzögerungen" bei der Zollbearbeitung. Laut Edouard Gouin vom Kunsttransportdienstleister Convelio wird der US-Import durch fehlende temporäre Einfuhrregelungen zusätzlich erschwert. Für Antiquitäten oder Designstücke mit Aluminium oder Stahlanteil fallen sogar bis zu 25 Prozent zusätzliche Zölle an. "Viele unserer Kunden haben bereits erklärt, dass sie ihre Teilnahme an US-Messen überdenken", so Gouin. Die Art Dealers Association of America arbeite derweil an einer "maßgeschneiderten Strategie", um den Import und Export von Kunstwerken rechtssicherer zu gestalten, so Geschäftsführerin Kinsey Robb. Gouin empfiehlt Händlern, sorgfältige Versanddokumentationen zu erstellen und ihre Kundenbasis stärker auf weniger betroffene Regionen auszurichten. Trotz allem zeigt er sich verhalten optimistisch: "Sobald sich die makroökonomischen Bedingungen stabilisieren, erwarte ich eine allmähliche Normalisierung." Für den "Standard" hat sich Olga Kronsteiner das Thema angeschaut. "So ungewiss der Ausgang an dieser Handelsfront ist, die derzeitige Unsicherheit könnte dazu führen, dass sich die Verkäufe noch stärker in den privaten Bereich verlagern, konkret in Zollfreilager", bilanziert sie.
In der "New York Times" berichten Zachary Small und Julia Halperin über die Dominanz der Galerie Hauser & Wirth in den wichtigsten New Yorker Museen. Eine Analyse von über 350 Einzelausstellungen zeitgenössischer Künstler seit 2019 zeigt, dass fast ein Viertel der Ausstellungen Künstler von nur elf großen Galerien repräsentiert, wobei Hauser & Wirth mit 18 Shows am stärksten vertreten ist. Galeriedirektor Marc Payot erklärt: Galeriedirektor Marc Payot erklärt: "Eine institutionelle Präsenz ist der wichtigste Aspekt für die Langlebigkeit der Karriere eines Künstlers." Gleichzeitig warnen Experten vor Interessenskonflikten, da Museumsauftritte den Wert der Werke und den Profit der Galerien steigern können. Während früher "es tabu war, Galerien um Geld zu bitten", wie der Kurator Michael Darling sagt, sind Museen heute finanziell auf diese Unterstützung angewiesen. Hauser & Wirth bietet nicht nur finanzielle Hilfe, sondern auch logistische Unterstützung und vermittelt Leihgaben. Diese Entwicklung verändert laut Small und Halperin nachhaltig die Beziehungen zwischen Museen und der kommerziellen Kunstwelt.
Museen
Die "FAS" erschien am Wochenende aus dem kuriosen Anlass der Verhaftung des Fälschers Wolfgang Beltracchi vor 15 Jahren mit einem Schwerpunkt zum Thema Original und Fälschung. Im Rahmen dessen hat Laura Helena Wurth das Rathgen-Forschungslabor in Berlin besucht, das als "Rechtsmedizin der Kunst" gilt. Dort werden Gemälde mit modernsten Verfahren wie UV-, Infrarot- und Röntgenstrahlen sowie Dendrochronologie untersucht, um deren Echtheit zu prüfen. Direktor Stefan Simon betont: "Ein Bild wird nicht als Fälschung geboren." Das Labor liefert naturwissenschaftliche Fakten, doch die endgültige Bewertung erfolgt in Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern und Strafverfolgern. Besonders bekannt ist das Institut für die Überführung von Fälschungen, wie etwa bei Werken von Beltracchi. Simon erklärt: "Wenn das Gemälde einmal im Museum hängt, kann der Fälscher nichts mehr machen." Neben der Echtheitsprüfung steht auch die Konservierung von Kunstwerken im Fokus der Arbeit.
Interview
Im "Zeit"-Interview mit Florian Illies und Giovanni di Lorenzo blickt der 95-jährige Künstler Günther Uecker auf ein bewegtes Leben zurück: Kriegskindheit, DDR-Jugend und die Entwicklung seiner Nagelkunst. Er spricht über die schwierige Beziehung zu seinem Vater und prägende Kriegserlebnisse, darunter das Vernageln des Hauses zum Schutz: "Das war die Gewöhnung an ein Werkzeug", erklärt Uecker. Seine Flucht aus der DDR und die künstlerische Entfaltung in Düsseldorf werden ebenso beleuchtet wie seine Beziehungen zu Künstlerkollegen wie Gerhard Richter und Joseph Beuys. Uecker erörtert die spirituelle Dimension seiner Kunst, die sich in seinen blauen Kirchenfenstern im Schweriner Dom manifestiert. Er teilt seine Erfahrungen mit existentiellen Ängsten, betont die schützende Funktion der Angst und die Wiederkehr alter Traumata angesichts des Ukraine-Kriegs. Trotz seines hohen Alters zeigt er eine bemerkenswerte Lebensfreude und Schaffenskraft, verbunden mit einer tiefen Liebe zur Natur in seinem Refugium in Wustrow. "Tanzen tue ich auch gern", fügt er hinzu.